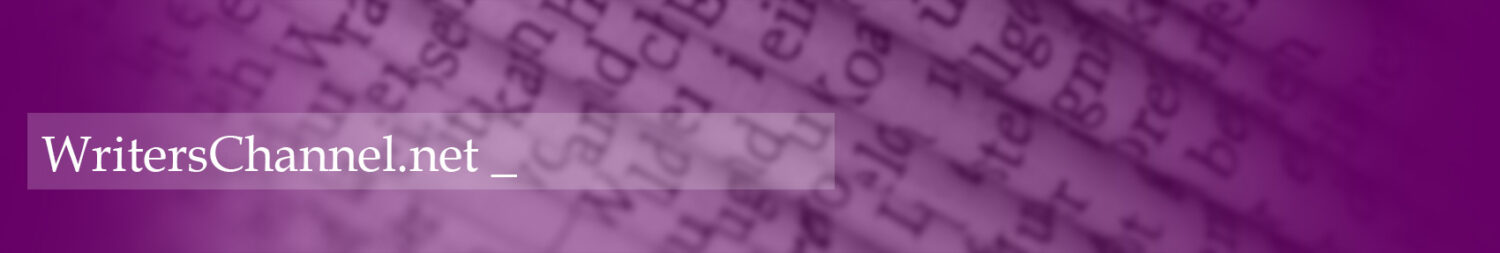Der Krieg in der Ukraine und die Entwicklung von Bodendrohnen: Der stille Aufstieg der Kampfroboter
Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 ist das osteuropäische Land nicht nur Schauplatz eines geopolitischen Konflikts, sondern auch ein Labor für moderne Waffentechnologie.
Während Kampfdrohnen aus der Luft, wie die türkische Bayraktar oder iranische Shahed-Drohnen, große mediale Aufmerksamkeit erhalten haben, vollzieht sich am Boden eine technologische Revolution: die rapide Entwicklung und massenhafte Nutzung von unbemannten Bodenfahrzeugen (UGVs). Diese „Bodendrohnen“ sind längst mehr als ferngesteuerte Spielzeuge – sie sind Teil eines neuen Kriegszeitalters.
Definition und Typen von Bodendrohnen
Bodendrohnen oder unbemannte Bodenfahrzeuge (englisch: Unmanned Ground Vehicles, UGVs) sind robotische Systeme, die ohne Besatzung auf dem Boden operieren. Man unterscheidet sie nach Funktionen und Steuerungsgrad. Manche werden manuell ferngesteuert, andere nutzen GPS-Navigation, Sensorik oder einfache KI-Algorithmen, um autonom zu agieren.
Die wichtigsten UGV-Kategorien im ukrainischen Kontext sind:
- Transportdrohnen – Sie bringen Munition, Wasser oder medizinisches Material zur Front.
- Evakuierungsdrohnen – Systeme wie Murakha können Verwundete automatisch zurückbringen.
- Kampfroboter – etwa Droid 12.7 mit Maschinengewehrturm, geeignet für direkte Angriffe.
- Störsysteme zur elektronischen Kriegsführung – z. B. Berserk, das gegnerische Drohnen durch Funksignale lahmlegt.
Warum UGVs in der Ukraine boomen
Der ukrainische Generalstab hat den Bedarf an innovativer Technik früh erkannt. Die Gründe für den UGV-Boom sind vielfältig:
- Der chronische Personalmangel und hohe Blutzoll auf beiden Seiten zwingen zur Automatisierung.
- Das Gelände vieler Frontabschnitte ist zu gefährlich für Menschen – Roboter sind risikofreudiger.
- Der Krieg bietet ein einzigartiges reales Testfeld für Prototypen – die Ukraine wird unfreiwillig zum Technologielabor.
Ein anonymer ukrainischer Entwickler sagte gegenüber RiffReporter: „Was bei uns funktioniert, wird morgen Standard in anderen Armeen sein.“
Wachstum und Zahlen
Die Ukraine hat den strategischen Wert erkannt und im Februar 2024 eine eigene Teilstreitkraft gegründet: die Unmanned Systems Forces. Bereits über 5.000 Mitglieder arbeiten dort an der Erprobung, Wartung und dem Einsatz unbemannter Systeme.
Präsident Selenskyj kündigte im Frühjahr 2025 an, dass „bis Ende 2025 rund 15.000 Bodendrohnen an der Front verfügbar sein sollen“. Dabei hilft ein Netzwerk aus staatlich geförderten Start-ups (z. B. Brave1, Kvertus), internationalen Partnern und Crowdfunding-Aktionen.
Technologische Neuerungen und Systeme
Ein auffälliger Trend ist die Modularität. „Die neuen Drohnen funktionieren wie Lego – sie können mit verschiedenen Komponenten umgebaut werden, je nach Einsatz“, erklärt ein Entwickler gegenüber Business Insider.
Beispiele für technologische Sprünge:
- Protector: Ein gepanzertes UGV mit Tragekapazität von 200 kg und Kettenantrieb für unwegsames Gelände.
- Droid 12.7: Ferngesteuert mit 12,7-mm-Maschinengewehr ausgestattet, wurde erfolgreich bei der Verteidigung von Bachmut eingesetzt.
- Berserk: Ausgestattet mit Funkstörsendern, die russische Kamikazedrohnen wie Shahed-136 deaktivieren können.
- Fiber-optic-Uplink: Neue Bodendrohnen kommunizieren über Glasfaserkabel, um elektronische Störungen zu umgehen. „Damit ist das russische Störfeuer praktisch wirkungslos“, so ein Drohneningenieur.
Beispielhafte Einsätze
Ein Fall, der medial Aufsehen erregte, war der Einsatz eines Roboterteams bei der Offensive nahe Charkiw im Mai 2025. Ukrainische Quellen berichten, dass dort erstmals ein kompletter Vorstoß mit Boden- und Luftdrohnen durchgeführt wurde – ganz ohne menschliche Soldaten im Vorfeld.
Besonders eindrucksvoll: Eine Evakuierungsdrohne brachte unter feindlichem Feuer zwei Verwundete zurück. Gleichzeitig deckte eine Kampfdrohne das Areal mit Maschinengewehrsalven.
In einem Interview mit Nau.ch erklärt ein ukrainischer Kommandeur: „Ich hatte früher Angst, meine Leute durch Minen oder Drohnen zu verlieren. Jetzt schicken wir Roboter – und sie kommen oft zurück.“
Schwächen und Hürden
So faszinierend der technologische Fortschritt ist – er hat seine Grenzen:
- Viele Systeme sind noch auf menschliche Fernsteuerung angewiesen. Echte Autonomie existiert kaum.
- Infrastrukturprobleme: Batterien laden im Feld, Reparaturen im Schützengraben – all das bleibt schwierig.
- Kosten: Ein voll ausgestatteter Kampfroboter kann über 40.000 € kosten.
- Verlustquote: Wegen Artillerie, Minen oder technischen Ausfällen geht ein erheblicher Teil verloren.
Ein Soldat resümiert: „Für jede erfolgreiche Mission verlieren wir im Schnitt zwei Maschinen.“
Internationale Perspektive
Westliche Firmen sehen in der Ukraine eine Testplattform. „Unsere Prototypen überleben hier – oder sie tun es nicht. Es gibt keinen besseren Ort für reale Belastungstests“, so ein Manager von Milrem Robotics (Estland), Hersteller der THeMIS-UGVs.
Auch US-Waffenhersteller liefern Baupläne, Steuerungssysteme oder Komponenten. Die Ukraine exportiert ihrerseits Know-how: Zahlreiche europäische Armeen beobachten die Entwicklungen genau. Das deutsche Bundesamt für Ausrüstung testet derzeit UGVs nach ukrainischem Vorbild in einem Logistikprojekt bei der Bundeswehr.
Zukunft und Ethik
Militärexperten gehen davon aus, dass bis 2030 ein erheblicher Teil der Kriegsführung durch autonome Systeme abgebildet wird. Der Bodenkrieg – bislang ein Synonym für menschliches Leid und Zermürbung – könnte roboterisiert werden.
Doch die ethischen Fragen bleiben:
- Dürfen Maschinen töten, ohne menschliches Zutun?
- Wer haftet bei Fehlfunktionen?
- Was passiert, wenn Roboter gegen Roboter kämpfen – aber Menschen im Kreuzfeuer stehen?
Ein kritischer Kommentar aus der Kyiv School of Economics warnt: „Wenn der Krieg zur Computersimulation wird, wird der Mensch überflüssig – oder zur Zielscheibe.“
Fazit
Die Ukraine hat sich binnen weniger Jahre zu einem Pionierland in Sachen Bodendrohnen und Roboterkrieg entwickelt. Mit jeder neuen Lieferung, jedem zerstörten Roboter und jeder geretteten Leben zeigt sich das Potenzial – aber auch die Ambivalenz dieser Technologie.
Bodendrohnen können Leben retten, indem sie gefährliche Aufgaben übernehmen. Doch sie können auch als Blaupause für zukünftige Konflikte dienen, in denen Maschinen den Ton angeben. Der stille Aufstieg der Kampfroboter hat begonnen – nicht im Silicon Valley, sondern in den Trümmerfeldern von Donezk, Bachmut und Charkiw.