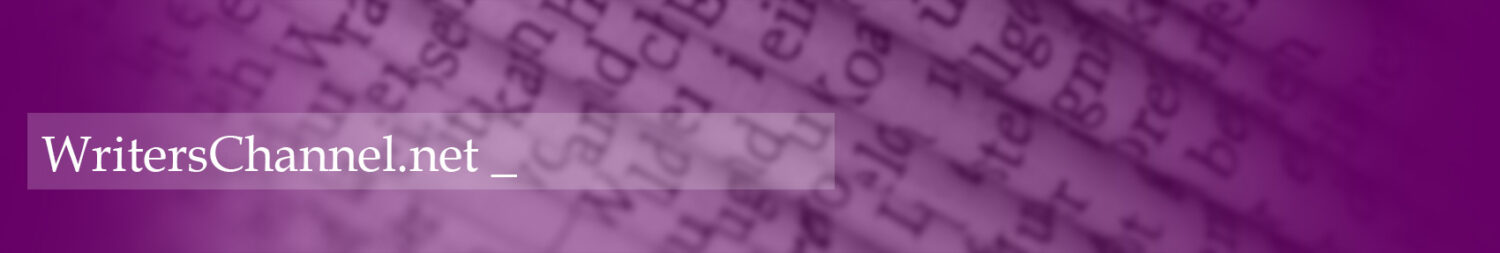Warum Zoos gesunde Tiere töten – Hintergründe und Kritik
Die Vorstellung, dass gesunde Tiere in Zoos getötet werden, sorgt bei vielen Menschen für Empörung. Zoos gelten als Orte des Artenschutzes, der Bildung und Forschung – und nicht als Schauplätze gezielter Tötungen.
Doch die Realität sieht differenzierter aus. Im Juli 2025 sorgte ein Fall aus dem Nürnberger Tiergarten für große mediale Aufmerksamkeit: Zwölf gesunde Guinea-Paviane wurden dort getötet. Der Fall warf eine ethisch brisante Frage auf: Warum töten Zoos Tiere – und dürfen sie das überhaupt?
Hintergrund: Zuchtprogramme und Populationsmanagement
Die meisten zoologischen Gärten in Europa arbeiten nach den Standards des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP), das von der Europäischen Zoo- und Aquarienvereinigung (EAZA) koordiniert wird. Ziel dieser Programme ist es, gefährdete Tierarten zu erhalten und deren genetische Vielfalt langfristig zu sichern. Dabei wird nicht nur die Art als Ganzes betrachtet, sondern auch der Genpool innerhalb der Zoo-Populationen gesteuert. Um Inzucht zu vermeiden und die genetische Diversität zu wahren, ist eine selektive Fortpflanzung notwendig. Das bedeutet: Nicht jedes Tier darf sich fortpflanzen, und nicht jedes geborene Tier kann dauerhaft im Zoo verbleiben.
Ein Zuchtkoordinator entscheidet dabei auf Basis genetischer und zoologischer Daten, welche Tiere Nachwuchs bekommen dürfen und welche nicht. Zoos planen mitunter über Generationen hinweg – häufig mit einem Zeithorizont von 100 Jahren. Tiere, deren genetisches Profil bereits überrepräsentiert ist, gelten als „überschüssig“ für den Erhalt der gewünschten genetischen Vielfalt.
Gründe für die Tötung
Überbevölkerung und Platzmangel
Zoos haben begrenzte Kapazitäten. Wenn zu viele Tiere einer Art vorhanden sind, entsteht ein Platzproblem – insbesondere bei sozialen Tieren wie Primaten. So geschehen im Tiergarten Nürnberg. Die dortige Guinea-Pavian-Gruppe war über Jahrzehnte auf über 50 Tiere angewachsen. Eine natürliche Verkleinerung durch Auswilderung war nicht möglich, da es für diese Tierart keine geschützten Rückführungsgebiete gibt. Versuche, Tiere an andere Zoos abzugeben, blieben erfolglos. Auch Bemühungen, die Fortpflanzung durch hormonelle Verhütung zu kontrollieren, scheiterten laut Angaben des Zoos.
„Wir hatten schlicht keine andere Wahl“, sagte der Direktor des Nürnberger Tiergartens. „Einzelne Paviane verursachten durch aggressives Verhalten schwere Verletzungen innerhalb der Gruppe. Eine Umstrukturierung war unter diesen Umständen nicht möglich.“ Die Tötung wurde demnach als letztes Mittel angesehen, um das soziale Gleichgewicht der Gruppe zu erhalten.
Genetischer Druck und Selektion
Im Rahmen der Zuchtplanung spielen auch genetische Kriterien eine zentrale Rolle. Tiere, deren Erbanlagen zu häufig in der Population vertreten sind, werden häufig nicht weiter zur Zucht eingesetzt. Doch selbst wenn sie aus der Zucht genommen werden, bleibt ihr Fortbestand im Zoo nicht zwangsläufig gesichert. Denn wenn es weder einen Zuchtwert noch ein soziales oder ökologisches Einsatzgebiet für das Tier gibt, wird es häufig als „überschüssig“ eingestuft.
Ein Veterinär aus Berlin, der anonym bleiben möchte, erklärt: „Manchmal entspricht ein Tier zwar dem Artenschutzaspekt, aber nicht dem genetischen Ideal. Dann stehen wir vor einem ethischen Dilemma – besonders wenn kein anderer Zoo das Tier übernehmen kann.“
Tötung für Futterzwecke
Ein weiteres – häufig wenig bekanntes – Motiv für die Tötung von Zootieren ist ihre Verwertung als Futtertiere. Vor allem in größeren Zoos werden regelmäßig Ziegen, Kaninchen oder Schafe gezüchtet, um Fleischfressern wie Löwen, Tigern oder Schlangen artgerechte Nahrung bieten zu können. Die Tiere werden dabei unter kontrollierten Bedingungen gehalten, getötet und direkt verfüttert. Diese Praxis gilt unter Zoologen als notwendig, um das natürliche Fressverhalten der Raubtiere zu erhalten.
In manchen Fällen sorgt auch dies für öffentliche Aufregung, wie etwa 2014 im Kopenhagener Zoo. Damals wurde eine junge Giraffe namens Marius trotz internationaler Proteste öffentlich getötet und anschließend an Löwen verfüttert. Der Zoo verteidigte die Entscheidung mit dem Hinweis, Marius’ Gene seien für die Zucht ungeeignet.
Keine Auswilderung möglich
Oftmals wird die Frage gestellt, warum Zoos überzählige Tiere nicht einfach in die Freiheit entlassen. In der Praxis ist dies aber kaum möglich. Viele Zootiere wurden über Generationen in menschlicher Obhut gezüchtet und sind nicht mehr an das Leben in freier Wildbahn angepasst. Außerdem fehlt es für viele Tierarten an geeigneten und sicheren Auswilderungsflächen.
Im Fall der Guinea-Paviane aus Nürnberg lag das zusätzliche Problem vor, dass ihre genetische Herkunft nicht mehr exakt auf eine bestimmte Population im Ursprungsgebiet (etwa in Guinea, Senegal oder Mali) zurückführbar war. Eine Auswilderung wäre damit ökologisch und genetisch unverantwortlich gewesen.
Rechtliche und ethische Bewertung
In Deutschland ist das Töten von Wirbeltieren durch das Tierschutzgesetz streng geregelt. Laut § 1 dürfen Tiere nur getötet werden, wenn ein „vernünftiger Grund“ vorliegt. Doch was ist „vernünftig“? Während Zoos den Populationsdruck und das genetische Management als triftige Gründe anführen, sehen Tierschutzorganisationen wie PETA oder der Deutsche Tierschutzbund diese Praxis kritisch.
„Ein gesunder Pavian, der getötet wird, weil er nicht ins Zuchtprogramm passt, ist kein Ausnahmeszenario, sondern Symptom eines Systems, das Tiere als verwaltbare Objekte betrachtet“, kritisiert eine Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Die Organisation wirft den Zoos ein veraltetes Selbstverständnis vor und fordert eine Abkehr von der Praxis der „Selektion durch Tötung“.
Auch juristisch ist die Lage umstritten. Tierschutzjuristen argumentieren, dass wirtschaftliche oder organisatorische Gründe – etwa Platzmangel – kein „vernünftiger Grund“ im Sinne des Gesetzes sein dürfen. Eine gerichtliche Klärung dieser Frage steht bislang aus.
Aktuelle Kontroversen und Fallbeispiele
Neben dem Nürnberger Fall gibt es immer wieder Vorfälle, die die Diskussion neu entfachen. Im Zoo von Odense in Dänemark wurde 2021 ein Löwe getötet, weil es für ihn keinen Platz mehr gab. In München kam es 2023 zur Tötung von sieben Ziegen, die aus Zuchtüberschüssen stammten. Und 2024 wurde bekannt, dass in mehreren europäischen Zoos rund 300 Tiere pro Jahr gezielt eingeschläfert oder erschossen werden – darunter auch Jungtiere.
Ein Zooleiter erklärte anonym: „Diese Zahlen sind notwendig, wenn man die genetische Qualität der Population erhalten will. Natürlich ist das kein angenehmer Teil unserer Arbeit, aber eine Realität in einem begrenzten System.“
Stellungnahmen und Gegenargumente
Zoos verteidigen ihre Praxis mit dem Hinweis auf ihren Bildungs- und Artenschutzauftrag. Sie argumentieren, dass kontrollierte Zucht und gelegentliche Tötungen die langfristige Erhaltung bedrohter Arten ermöglichen. Viele Vertreter verweisen auf Erfolge wie die Wiederansiedlung von Przewalski-Pferden oder europäischen Wisenten in der Natur, die ohne zoologische Unterstützung nicht möglich gewesen wäre.
„Die Entscheidung, ein Tier zu töten, wird nie leichtfertig getroffen“, betonte ein Sprecher des Verbands der Zoologischen Gärten (VdZ). „Wir wägen das Wohl des Individuums gegen das Wohl der gesamten Population ab.“
Demgegenüber fordern Tierschutzorganisationen eine grundlegende Neuausrichtung von Zoos. PETA schlägt etwa den Übergang zu Auffangstationen und Bildungszentren vor, die keine Zuchtprogramme betreiben. Auch die Initiative „Citizen Conservation“ plädiert für alternative Wege des Artenschutzes, bei dem Tiere in geschützten Anlagen von privaten und institutionellen Partnern gehalten werden – ohne Überschusserzeugung.
Alternativen und Lösungsansätze
- Verbesserung der Vermittlungsnetzwerke zwischen Zoos zur Reduktion von Überschusstieren.
- Einsatz hormoneller Verhütung zur Vermeidung ungeplanter Fortpflanzung.
- Verzicht auf selektive Zucht bei Arten, die keine unmittelbare Auswilderungsperspektive haben.
- Förderung von Tierlebenshöfen und spezialisierten Auffangstationen als Ergänzung zu klassischen Zoos.
Ein mögliches Zukunftsmodell könnte eine klare Trennung zwischen Zoos mit aktivem Zuchtauftrag und tierfreundlichen Reservaten sein, in denen Tiere dauerhaft unter naturnahen Bedingungen leben können – unabhängig von ihrem Zuchtwert.
Ein tiefgreifender ethischer Konflikt
Die Tötung gesunder Tiere in Zoos stellt einen tiefgreifenden ethischen Konflikt dar. Zwischen genetischer Verantwortung, Platzkapazitäten und Tierschutzrechten tun sich Spannungsfelder auf, die in der Öffentlichkeit zunehmend kritisch betrachtet werden. Der Fall der Paviane in Nürnberg zeigt, wie fragil das gesellschaftliche Vertrauen in zoologische Einrichtungen geworden ist.
Zoos stehen daher vor der Herausforderung, ihre Strategien nicht nur gegenüber Fachgremien, sondern auch gegenüber der Gesellschaft zu rechtfertigen. Transparenz, klare ethische Leitlinien und eine ehrliche Debatte über die Zukunft der Tierhaltung im Artenschutz sind notwendiger denn je.
Ob die Tötung eines einzelnen Tieres dem Schutz vieler dienen kann – diese Frage wird Zoos, Juristen und Ethiker auch in Zukunft beschäftigen.