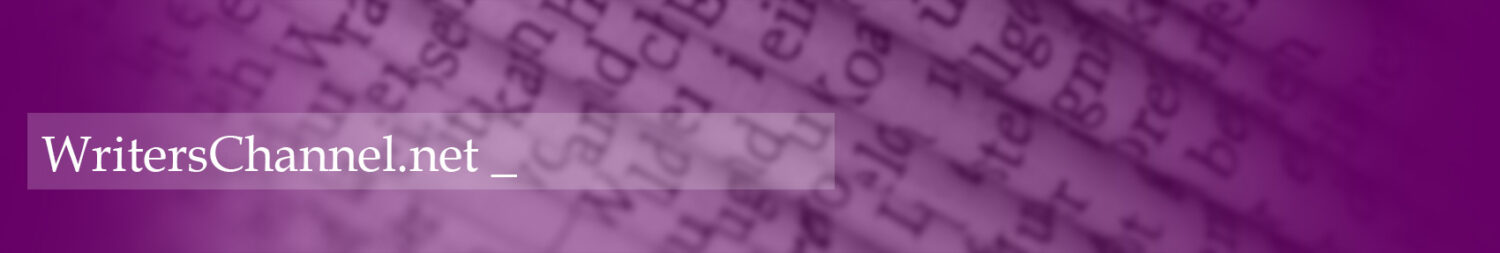Was ist cool? – Eine Reise durch Zeit, Kultur und Forschung
„Cool sein“ – ein Begriff, der sich durch Alltagsgespräche, Werbung, Jugendkultur und Popgeschichte zieht. Doch was genau bedeutet „cool“ eigentlich?
Ist es eine Modeerscheinung, ein Charakterzug oder ein gesellschaftliches Ideal? In einem Zeitalter der Selbstinszenierung und ständigen Selbstdarstellung, besonders in sozialen Medien, scheint Coolness ein flüchtiges, aber begehrtes Gut zu sein. Eine aktuelle internationale Studie zeigt, dass Vorstellungen von Coolness rund um den Globus erstaunlich ähnlich sind. Dies bietet Anlass, dem Begriff auf den Grund zu gehen – historisch, sozialpsychologisch und kulturell.
Historischer Ursprung des Coolness-Begriffs
Das Adjektiv „cool“ bedeutete ursprünglich schlicht „kühl“, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne – also ruhig, gelassen, beherrscht. Schon im 18. Jahrhundert wurde der Begriff in englischer Literatur verwendet, um eine stoische Haltung auszudrücken. Der moderne Coolness-Begriff wurde jedoch stark durch afroamerikanische Kultur geprägt. In der Jazz-Ära der 1940er Jahre etablierte sich „cool“ als ästhetisches Ideal: Musiker wie Lester Young galten als „cool“, wenn sie mit scheinbar müheloser Leichtigkeit ihre Musik darboten – unaufgeregt, souverän, emotional kontrolliert.
In den 1950er Jahren griff die Beat Generation diese Haltung auf. Coolness wurde zum rebellischen Gegenmodell zur bürgerlichen Norm: distanziert, anti-autoritär, nonchalant. Marlon Brando, James Dean und später Bob Dylan oder Patti Smith verkörperten diese neue Kultur der Zurückhaltung – nicht laut und exzentrisch, sondern zurückgelehnt und unangepasst.
Soziokulturelles Konzept Coolness
Coolness ist weniger eine objektive Eigenschaft als vielmehr ein soziales Urteil. Der Soziologe Dick Pountain bezeichnete Coolness als eine „moralische Haltung, ein stilisiertes Verhalten in Reaktion auf äußere Unterdrückung oder Repression“. Wer cool ist, wirkt überlegen, souverän, aber unbeteiligt – ein subtiler Akt des Widerstands gegen Anpassungsdruck.
In der afrikanischen Diaspora hat sich diese Form des inneren Gleichgewichts sogar als kulturelles Konzept etabliert. Das aus der Yoruba-Kultur stammende Prinzip Itutu steht für Anmut, Selbstbeherrschung und ästhetisches Auftreten trotz äußerer Widrigkeiten. Es ist kein Zufall, dass gerade marginalisierte Gruppen in Coolness ein Mittel der Selbstbehauptung fanden.
Empirische Forschung: Universelle Merkmale
Eine 2025 veröffentlichte, internationale Studie mit über 6.000 Teilnehmenden aus 13 Ländern (darunter China, Chile, Nigeria und die USA) brachte interessante Ergebnisse hervor: Trotz kultureller Unterschiede stimmen Menschen weltweit weitgehend darin überein, was sie als „cool“ empfinden. Sechs Hauptmerkmale kristallisierten sich heraus:
- Extraversion: soziale Kompetenz, Ausstrahlung, Charisma
- Hedonismus: Genussfreude, Lebenslust
- Machtorientierung: Durchsetzungskraft, Einflussnahme
- Abenteuerlust: Mut, Risikobereitschaft, Neugier
- Offenheit: kulturelle Flexibilität, Neugier auf Neues
- Autonomie: Unabhängigkeit, Selbstbestimmtheit
Interessanterweise scheinen diese Eigenschaften in sehr verschiedenen Gesellschaftssystemen als attraktiv und „cool“ wahrgenommen zu werden. Der Soziologe Prof. Friedrich Götz, einer der Studienautoren, betont: „Coolness ist ein globales Phänomen – sie zeigt uns, wie ähnlich sich Menschen in ihrer Bewertung von Persönlichkeit trotz kultureller Unterschiede sind.“
Cool vs. „Gut“ – Eine notwendige Abgrenzung
Was cool ist, muss nicht unbedingt gut im moralischen Sinne sein. Während „gute“ Menschen oft als warmherzig, traditionsverbunden oder gewissenhaft gelten, bringt Coolness auch moralisch ambivalente Eigenschaften mit sich. Ein „cooler“ Mensch muss nicht unbedingt hilfsbereit oder empathisch sein. Im Gegenteil: Die Ausstrahlung von Autonomie und Unabhängigkeit grenzt sich bewusst von sozialer Konformität ab.
James Bond etwa gilt als Inbegriff von Coolness – charmant, risikobereit, souverän. Doch seine Methoden sind oft zweifelhaft, sein moralischer Kompass verschoben. Coolness lebt von diesem Spannungsfeld zwischen Bewunderung und Unnahbarkeit. Sie ist mehr Stil als Substanz, mehr Haltung als Tugend.
Warum Coolness heute wichtig ist
In modernen Gesellschaften übernimmt Coolness eine Funktion, die weit über Stilfragen hinausgeht. Sie bietet Orientierung in einer Welt ständiger Veränderung. Cool zu sein bedeutet, nicht nur im Trend zu liegen, sondern dem Trend voraus zu sein – oder sich ihm bewusst zu entziehen. Die coole Haltung steht für Resilienz, kreative Eigenständigkeit und soziale Souveränität.
In sozialen Medien, in denen Inszenierung zur Alltagskultur geworden ist, bedeutet Coolness: sich nicht um Likes zu scheren und dennoch Aufmerksamkeit zu bekommen. Authentische Coolness widersetzt sich der algorithmischen Logik von Popularität – sie lebt vom echten Eindruck statt von äußerer Bestätigung.
Coolness als Marketinginstrument
Natürlich bleibt auch das kommerzielle Interesse an Coolness nicht aus. Die Werbeindustrie hat den Begriff längst vereinnahmt. Marken wie Apple, Nike oder Red Bull inszenieren sich bewusst als „cool“, indem sie Innovation, Rebellion oder Stil verkörpern. Der Begriff wird in politischen Kampagnen genutzt („Cool Britannia“ in den 1990ern, „Cool Japan“ seit den 2000ern), um Nation Branding zu betreiben.
Der Kulturkritiker Noah Kerner prägte den Begriff „Chasing Cool“ – also das verzweifelte Hinterherlaufen eines Ideals, das sich jeder festen Definition entzieht. Coolness, so seine These, entzieht sich gerade dann, wenn sie gezielt erzeugt werden soll. Wer versucht, cool zu sein, ist es meist nicht.
Wandel und Kritik
Die ständige Vereinnahmung von Coolness durch Werbung, Musik und Social Media hat zu einem gewissen Bedeutungsverlust geführt. Manche Kulturkritiker sehen die ursprüngliche Kraft des Begriffs verwässert. Wenn jeder ein bisschen cool sein will, verliert das Konzept seine rebellische Spitze.
Zudem birgt Coolness sozialen Druck. Gerade Jugendliche verspüren oft die Notwendigkeit, einem bestimmten Coolness-Ideal zu entsprechen – was zu Unsicherheit, sozialer Überanpassung oder Identitätskonflikten führen kann. Das „Immer locker bleiben“ wird zum Performance-Druck.
Coolness war einst ein Gegenmodell zu Normierung – heute wird sie selbst zur Norm. Wer nicht cool ist, gilt als langweilig oder uncool. Diese Umkehrung zeigt: Auch ein subversives Konzept kann in die Logik der Konformität eingebunden werden.
Coolness kultivieren – aber wie?
Wer wirklich cool wirken will, sollte nicht danach streben. Authentizität ist der Schlüssel. Menschen, die bei sich bleiben, sich nicht verstellen und dennoch offen für Neues sind, strahlen jene Souveränität aus, die als cool empfunden wird.
Psycholog:innen empfehlen: Statt sich auf äußere Wahrnehmung zu fixieren, sollte man die eigene Haltung kultivieren – Gelassenheit, Selbstbeherrschung, Neugier und Respekt vor sich selbst. Coolness beginnt innen, nicht außen. Sie zeigt sich in der Art, wie wir mit Unsicherheit, Konflikten oder Herausforderungen umgehen – ob mit Panik oder Haltung.
Ein kulturelles Phänomen
Coolness ist mehr als ein Lifestyle – sie ist ein kulturelles Phänomen mit historischen Wurzeln, sozialer Funktion und psychologischer Tiefe. In einer Zeit, in der alles bewertet, inszeniert und kategorisiert wird, wirkt echte Coolness wie ein Paradox: Sie zieht Aufmerksamkeit an, ohne sie zu suchen. Sie inspiriert, ohne zu belehren. Sie lebt von Haltung, nicht von Hype.
Und sie ist universell: Trotz aller Unterschiede erkennen Menschen weltweit ähnliche Muster von Coolness – ein Zeichen dafür, dass es gemeinsame kulturelle Ideale gibt. Doch Coolness ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Sie wandelt sich mit der Gesellschaft, mit der Technik, mit den Medien. In einer zunehmend digitalen Welt könnte sie sogar noch wichtiger werden: als Gegengewicht zu Dauererregung, als Symbol für innere Ruhe, als Ausdruck von Freiheit.
Vielleicht ist das am Ende das coolste an der Coolness: Sie bleibt ein Geheimnis. Und genau deshalb bleibt sie faszinierend.